Saflor
Saflor (Carthamus tinctorius L.), auch bekannt als Färberdistel, ist eine vielseitige Kulturpflanze mit langer Tradition – und großem Potenzial für die Zukunft. Ursprünglich als Färbe- und Heilpflanze genutzt, hat sie sich heute als wertvolle Ölfrucht etabliert. Dank ihrer Trockenheitstoleranz, ihrer blütenreichen Insektenfreundlichkeit und ihrer genügsamen Ansprüche passt sie hervorragend in moderne, nachhaltige Fruchtfolgen. Die tiefreichende Pfahlwurzel ermöglicht eine sichere Entwicklung auch in niederschlagsarmen Regionen, trägt zur Bodenstrukturverbesserung bei und hilft dabei, Nährstoffe aus tieferen Bodenschichten zu erschließen. So kann sie zur Nährstoffretention und zur Minderung von Auswaschungsverlusten beitragen.






Botanik, Nutzung und Potential
Saflor (Carthamus tinctorius L.), auch bekannt als Färberdistel, ist eine alte Kulturpflanze aus der Familie der Korbblütler. Ursprünglich wurde sie zur Gewinnung roter und gelber Farbstoffe sowie als Heilpflanze genutzt. Heute wird Saflor vor allem als Ölfrucht angebaut: Die Samen liefern ein hochwertiges Speiseöl mit wahlweise hohem Linolsäure- oder Ölsäureanteil, begleitet von antioxidativ wirkenden Tocopherolen (Vitamin E). Diese Inhaltsstoffe machen Saflor besonders wertvoll für die Lebensmittelindustrie, Naturkosmetik und gesundheitsbewusste Ernährung.
Ökologisch wertvoll und Anpassung an den Klimawandel
Die intensive Blüte von Saflor bietet über mehrere Wochen reichlich Nahrung für Insekten und Bienen – insbesondere in der sonst oft blütenarmen Sommerzeit. Mit seiner tiefreichenden Pfahlwurzel erschließt Saflor auch in Trockenphasen Wasserreserven und eignet sich so besonders für niederschlagsarme Standorte. Zudem kann er Nährstoffe aus tieferen Bodenschichten aufnehmen und trägt damit zu einer effizienteren Ressourcennutzung im Ackerbau bei.
Anbauchancen in Mitteleuropa
Mit der Zunahme von Sommertrockenheit wächst das agronomische Potenzial von Saflor auch in Deutschland. Dank seiner Anspruchslosigkeit und Nischenfunktion kann Saflor zur Fruchtfolgediversifizierung beitragen. Die Resistenzzüchtung gegen Krankheiten gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung. Als abtragende Kultur ist Saflor ein wertvoller Baustein in vielfältigen und standortangepassten Fruchtfolgesystemen – insbesondere im ökologischen Landbau, wo herkömmliche Ölpflanzen wie Raps aufgrund von Schädlingsdruck oder Sonnenblumen wegen Durchwuchsproblemen nur eingeschränkt einsetzbar sind.
Saflor ist eine vielversprechende Ölpflanze für den ökologischen Landbau: Raps ist dort aufgrund massiver Schädlingsprobleme kaum beherrschbar, und bei Sonnenblume stellt der Durchwuchs eine große Herausforderung dar. Saflor dagegen punktet mit geringer Schädlingsanfälligkeit, guter mechanischer Pflegbarkeit und hoher Konkurrenzkraft. Die tiefreichende Pfahlwurzel trägt zur effizienten Nährstoffaufnahme aus tieferen Bodenschichten bei und kann helfen, Auswaschungsverluste zu minimieren – ein Vorteil insbesondere in ökologischen Systemen mit begrenzter Nährstoffverfügbarkeit.
Saflor bevorzugt gut durchlässige, tiefgründige Böden ohne Staunässe sowie sonnige Lagen. Die Aussaat erfolgt im Frühjahr, die Ernte im Spätsommer. Die Kultur ist konkurrenzstark, anpassungsfähig und stellt geringe Ansprüche an die Düngung. Sie eignet sich hervorragend zur Erweiterung getreidelastiger Fruchtfolgen, kann Krankheitszyklen durchbrechen und verursacht im Gegensatz zu Sonnenblumen kaum Probleme durch Durchwuchs in der Folgekultur. Saflor gilt als relativ robuste Kultur es sollten trotzdem Anbaupausen von mindestens 4 Jahren eingehalten werden, um Krankheitserreger im Boden zu reduzieren und eine gesunde Fruchtfolge zu gewährleisten.
- Düngung:
- Saat:
Saat Ende März bis Mitte April bei günstigem warmen Wetter in ein feinkrümeliges, abgesetztes und abgetrocknetes Saatbett (so früh wie möglich)
Leichte Spätfröste bis -7°C werden von Saflor im Rosettenstadium toleriert
Aussaat mit Getreidedrilltechnik mit einer Saattiefe von ca. 3cm
Alternativ ist auch eine Aussaat in weiter Reihe (Reihenabstand 37,5–50 cm) möglich, um den späteren Einsatz der Maschinenhacke zu ermöglichen
Empfohlene Saatstärke 70-90 keimfähige Samen pro qm (TKG etwa 35g, Saatmenge: 25-35kg/ha)
Unmittelbar nach der Saat: Anwalzen zur guten Bodenschlussbildung
- Kulturpflege:
Schonendes Blindstriegeln, ca. 3-4 Tage nach Saat
Vorsichtiges und schonendes Striegeln nach Aufgang ab dem 1. Laubblattpaarstadium insgesamt 2-3 Striegeldurchgänge im Abstand von etwa 3-5 Tagen (Achtung: Als erstes kommen die Keimblätter, hier auf keinem Fall striegeln. Saflor ist in diesem Stadium sehr empfindlich)
Ernte:
Anfang/Mitte September mit dem Mähdrescher (Einstellung ähnlich wie bei Sonnenblume)
In der Regel ist keine Trocknung erforderlich. Liegt der Feuchtegehalt des Ernteguts jedoch über 9 %, sollte es unmittelbar nach der Ernte getrocknet werden
Andüngung vor der Saat auf 80-100kg/ha incl. N-min (0 - 60 cm)
Im Rosettenstadium ist Saflor nur gering konkurrenzfähig gegenüber Unkräutern. Mit Beginn des Streckungswachstums (Ende Mai) entwickelt sich jedoch eine robuste und durchsetzungsstarke Kultur.
Saflor gilt insgesamt als robuste Kultur mit geringer Anfälligkeit für Schaderreger. In feuchten Jahren, in niederschlagsreichen Anbauregionen oder bei Verwendung nicht angepasster Sorten können jedoch pilzliche Erkrankungen auftreten, die unter ungünstigen Bedingungen erhebliche wirtschaftliche Verluste bis hin zum Totalausfall verursachen können. Eine gute Fruchtfolgegestaltung und standortangepasste Sortenwahl sind zentrale Maßnahmen zur Vorbeugung. Vogelfraß ist im Vergleich zu Sonnenblumen deutlich seltener ein Problem. Im folgenden sind die wichtigsten Schaderreger bei Saflor aufgezählt.
Pilzliche Schaderreger
- Rost (Puccinia carthami)
- Alternaria (Alternaria carhami)
- Ramularia (Ramularia cercosporelloides)
- Köpfchenfäule (Botytis cinera, auch Sclerotinia sclerotiorum)
Insekten
- Bohrfliege (Acantiophilus helianthi), bislang selten aufgetreten
- Blattläuse
- Distelfalter (Vanessa cardui), bislang selten aufgetreten
Bakterien
Bakterielle Spizenwelke, bakterielle Blattfleckenkrankheit (Pseudomonas syringae)
Viren
- Gurken-Mosaik Virus (CMV)
Die Auswahl geeigneter Sorten ist entscheidend für den erfolgreichen Safloranbau. In Deutschland sind derzeit zwei Sorten Calin und Salem zugelassen. Beide zeichnen sich durch eine stabile Leistung und gute Anpassung an mitteleuropäische Bedingungen aus. Die Leistungsfähigkeit beider Sorten werden derzeit in mehrortigen Feldversuchen geprüft.
| Sorte: Calin (Linolsäure-Typ) | |
| Zulassungsjahr 2021 | |
| Züchter: | Vertrieb |
Gert Horn, exsemine GmbH Am Wehr 4 06198 Salzatal OT Zappendorf Email: g.horn@exsemine.de | Marold - Ökologischer Samenbau GmbH & Co. KG Hauptstraße 7 99955 Mittelsömmern Johanna Marold Tel.: 036041 / 5 76 76 Email: j.marold@bio-marold.de |
| Sorte: Salem (Linolsäure-Typ) | |
| Zulassungsjahr 2022 | |
| Züchter | Vertrieb |
Dr. Carsten Reinbrecht Saatzucht Streng-Engelen GmbH & Co. KG | Saatzucht Streng-Engelen GmbH & Co. KG Aspachhof 1 97215 Uffenheim Tel.: 09848 / 97 99 70 |
Weitere zugelassene Sorten im europäischen benachbarten Ausland:
- Frankreich: Perforator (Secobra)
- Niederlande: Summersun (Hamer Bloemzaden BV), Orange Grenade (Kieft Bloemzaden BV), Kinko, Zanzibar (Combifleur)
- Tschechien: Ara und Tereza (Research Institute for Fodder Crops, Ltd. Troubsko)
- Spanien und Türkei siehe CPVO
Saflor kann auf vielfältige Weise genutzt werden. Die Hauptverwertung liegt in der Gewinnung von Safloröl aus den Samen. Je nach Zuchtform ist es reich an Linolsäure oder Ölsäure und enthält antioxidativ wirksame Bestandteile wie Vitamin E. Der bei der Ölpressung anfallende Presskuchen eignet sich als proteinreiche Komponente im Mischfutter und bietet Potenzial für eine nachhaltige Tierernährung.
Im Vergleich zu international gehandeltem Saflor, dessen Ölgehalt häufig bei etwa 40 % liegt, erreicht lokal produzierter Saflor in Deutschland derzeit rund 25 %. Dies unterstreicht die Notwendigkeit züchterischer Verbesserungen zur Erhöhung der heimischen Wertschöpfung.
Darüber hinaus lassen sich die jungen Keimlinge von Saflor als sogenannte Microgreens direkt in der Küche verwenden – sie zeichnen sich durch ein angenehm nussiges Aroma und einen hohen Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen aus.
Traditionell wurde Saflor auch als Färberpflanze genutzt: Die getrockneten Blüten enthalten natürliche Farbstoffe wie Carthamidin und Carthamin und dienten in der Vergangenheit als Ersatz für Safran („falscher Safran“). Diese Anwendung erfährt heute eine neue Wertschätzung – etwa in der ökologischen Textilfärberei, in der Naturkosmetik und in der farblichen Gestaltung von Lebensmitteln („clean label“).
CarthBreed ist ein gemeinschaftliches Forschungsprojekt zur Etablierung eines modernen, standortangepassten Zuchtprogramms für Saflor in Deutschland. Ziel ist es, mit Hilfe moderner Methoden wie Speed-Breeding, Genomik und Schnellanalytik robuste, ertragsstabile und ökologisch geeignete Sorten zu entwickeln. Damit leistet CarthBreed einen aktiven Beitrag zur Umsetzung der Ackerbaustrategie 2035 – insbesondere in den Bereichen Pflanzenzüchtung, Klimaanpassung und Fruchtfolgediversität.
Projektziele
- Aufbau eines standortangepassten Saflor-Zuchtprogramms mit Resistenzzüchtung
- Steigerung von Ertrag und Ölgehalt
- Einsatz moderner Züchtungstechniken
Stärkung des ökologischen Landbaus
Methoden und Arbeitsplan
- Genetische Diversität: Sammlung von über 450 Saflorgenotypen als Startpunkt für die Züchtung
- Speed-Breeding: Etablierung eines Protokolls zur Generationsverkürzung
- Virusdiagnostik: Etablierung eines qPCR-Protokolls zum Nachweis von Virusinfektionen
- Genotypisierung und Markerentwicklung: GBS und KASP Marker
- Qualitätsanalytik: Bestimmung von Öl- und Proteingehalt mit NIRS und NMR
Ansprechpartner:
- Dr. Kim Steige
- Dr. Hans Peter Maurer
Projektpartner:
 exsemine GmbH, Gert Horn
exsemine GmbH, Gert Horn Streng-Engelen GmbH & Co. KG, Dr. Carsten Reinbrecht
Streng-Engelen GmbH & Co. KG, Dr. Carsten Reinbrecht
Finanzierung:
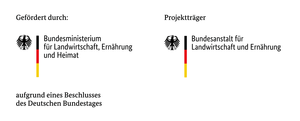
Die Förderung des Vorhabens erfolgt aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Heimat (BMELH) aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages. Die Projektträgerschaft erfolgt über die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) im Rahmen des Programms zur Innovationsförderung.
Sie interessieren sich für Saflor als Landwirt:in, Züchter:in, Verarbeiter:in oder Forscher:in?
Dann kontaktieren Sie uns via Email (Dr. Hans Peter Maurer, email: hpmaurer@uni-hohenheim.de).
Ziel ist es Saflorinteressierte zu vernetzen, über Saflor zu informieren und zu Veranstaltungen rund um Saflor einzuladen.
Besuchen Sie uns bei Veranstaltungen
- 25. Juli 2025: Hanf- und Saflor-Feldtag
- 16. Oktober 2025: Online Seminar Saflor, Veranstalter: Demeter Beratung e.V., Details folgen
